Das digitale Labor – die DGQ im Gespräch mit Matthias Freundel über die Zukunft von Laboren im Zeitalter der Digitalisierung8 | 07 | 19

Matthias Freundel ist Gruppenleiter am Fraunhofer IPA in Stuttgart. Er und sein Team beschäftigen sich mit digitalen Laborsystemen (Digital Lab Services). Sie unterstützen u. a. Industriepartner bei der Digitalisierung ihrer Laborprozesse.
Christina Eibert und Anna Schramowski, Produktmanagerinnen bei der DGQ, haben Matthias Freundel zum „Digitalen Labor“ interviewt und mit ihm über die Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken gesprochen.
Herr Freundel, was machen Sie und Ihr Team? Womit beschäftigen Sie sich?
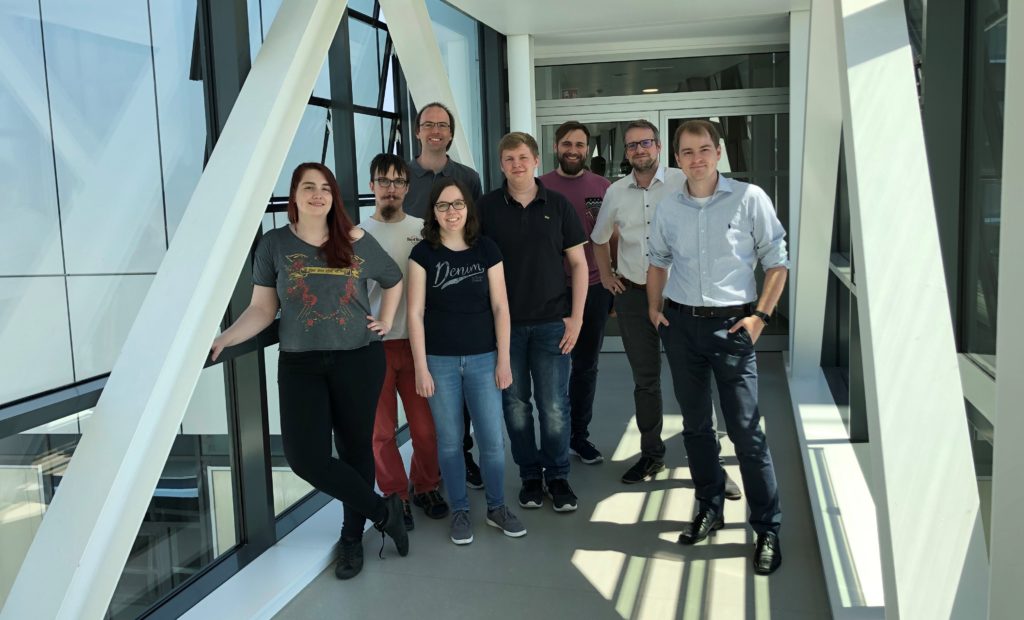
Matthias Freundel (rechts) und sein Team
Mein Team und ich beschäftigen uns allgemein mit der Digitalisierung im Labor. Wir erforschen, wie die Digitalisierung sich auf das Labor auswirkt, welche etablierten Technologien man einsetzen könnte, welche es schon gibt und welche Vorteile sich daraus für Labornutzer ergeben. Wir verfolgen verschiedene Projekte von entweder wenigen Tagen oder mehreren Jahren. Wir haben zum Beispiel auch klassische Softwareprojekte. Diese Projekte entstehen gemeinsam mit Firmen, um den Anwendungsfall neuer Technologien untersuchen zu können – also sozusagen live zu testen. Das Fraunhofer IPA hat u.a. die Aufgabe, die Forschung, die an der Uni betrieben wird und sehr grundlagenlastig ist, industrietauglich zu machen.
Können Sie Beispiele dieser neuen Technologien nennen?
Viele dieser Technologien kennen wir bereits aus dem privaten Konsumbereich. Einer meiner Mitarbeiter arbeitet zum Beispiel an Sprachsteuerung. Viele kennen Alexa oder Google Home aus dem Heimanwenderbereich. Sprachsteuerung ist ein natürlicher Weg, um mit Software zu interagieren. Wir überprüfen gerade, auch mit Partnern, wo es Sinn ergibt, diese Sprachsteuerung einzusetzen. Beispielsweise, wenn jemand bei Labortätigkeiten die Hände nicht frei hat. Allerdings kann man nicht einfach eine „Alexa“ ins Labor stellen. Wir haben Umgebungsbedingungen, die mit einbezogen werden müssen – so etwas wie Lautstärke, Stimmen, Umgebungsgeräusche, Sauberkeit.
Gestenerkennung ist noch nicht so verbreitet, aber von Fahrzeugen kennt man das schon. Die Frage ist: Wie kann Gestenerkennung helfen, wenn ich zum Beispiel Handschuhe anhabe aber eine Geste machen muss? Wie, wenn ich etwas dokumentieren möchte, ein Protokoll auf einem Display abrufen will ohne dabei die Handschuhe ausziehen zu müssen?
Was sind denn die Vorteile der digitalen Technologien im Labor? Die Investitionen müssen sich ja rentieren.
Im Endeffekt hat alles mit Zeit- oder Kostenersparnis zu tun. Logisch, denn sonst würde niemand investieren. Es geht aber auch darum, hochqualifiziertes Personal zu entlasten. Im Labor gibt es eine Reihe an Tätigkeiten, die, ich nenne es mal, nicht wertschöpfend sind. Wir versuchen mit der Digitalisierung Mitarbeitern wieder Raum zu geben, damit sie sich anderen und den eigentlich wertschöpfenden Tätigkeiten widmen können.
Wir haben zum Beispiel auf der „Labvolution“ einen mobilen Roboter zum Plattentransport vorgestellt. Der Plattentransport an sich ist nicht wertschöpfend, muss aber gemacht werden. Der Roboter kann diese Arbeit übernehmen und beispielsweise nachts oder am Wochenende Tätigkeiten ausführen, sodass niemand extra ins Labor kommen muss. Dadurch kann man den Menschen entlasten und unterstützen.
Fallen Ihnen spontan Beispiele für Vorteile ein, die sich im Hinblick auf das Qualitätsmanagement oder die Qualitätssicherung ergeben?
Das knüpft an vorher Gesagtes schon an. Dokumentation ist ein großes Thema. Wir arbeiten an einem Gestenarbeitsplatz. Da geht es darum, mit Sensorik zu erkennen, was der Mensch tut. Beim händischen Pipettieren ist es beispielsweise nicht möglich zu erkennen, ob die pipettierten Muster bis ins kleinste Detail stimmen. Denn bei vielen Pipettierschritten können Fehler entstehen. Wir versuchen mithilfe von Kameras und Abstandssensoren zu erkennen, was der Mensch genau gemacht hat. Danach gleichen wir ab, ob das zu dem passt, was im Protokoll steht. Der Abgleich mit dem Protokoll ermöglicht es dann, Labormitarbeiter auf Fehler hinzuweisen. Ein großer Vorteil davon ist, dass Fehler bereits während des Prozesses entdeckt werden, und nicht erst am Ende. Wenn man die Fehler früh erkennt, spart das Zeit und natürlich auch Geld. Der Gestenarbeitsplatz ist also eine Möglichkeit, den Nutzer dabei zu unterstützen, weniger Fehler zu machen. Da steckt aber noch viel Forschungsbedarf drin. Es benötigt noch Zeit, bis solche Systeme tauglich sind. Das hängt am Ende auch davon ab, wie der Nutzer dieses System einsetzen möchte.
Sie machen sich auch Gedanken darüber, wie Sie die generierten Daten nutzen können. Gibt es weitere Beispiele dafür, wie Daten generiert werden und wie Wissenschaftler diese dann nutzen können?
Ein klassisches Problem im Labor ist weiterhin die automatische Verknüpfung von Geräten. Da geht es darum, Daten zu Prozessschritten oder Ergebnisdaten zu erfassen und abzuspeichern. Diese Daten sind für die spätere Analyse wichtig. Anders als heute soll niemand mehr Werte abschreiben oder konvertieren müssen.
Ein weiteres Beispiel ist die Datenauswertung. Man hat Ergebnisse und wertet sie aus. Es müssen beispielsweise Kurven interpretiert und Schwellwerte festgelegt werden. Hier kann Machine Learning helfen, Ergebnisse zu klassifizieren.
Es geht aber auch darum herauszufinden, was überhaupt relevante Daten sind, die sich aufs Endergebnis auswirken können. Bei der Erfassung und der Aufzeichnung ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Man muss sich vorher gut überlegen, welche Daten man wofür sammelt.
Das klingt alles sehr positiv. Aber gibt es denn auch Risiken? Beispielsweise in Richtung der Informationssicherheit. Denken Sie das automatisch mit?
Ja, das ist vollkommen richtig. Die Digitalisierung hat auch gewisse Risiken. Bei jedem Anwendungsfall ist zu überlegen: Überwiegen die Vor- oder Nachteile?
Nachteile sind, und da müssen Unternehmen aufpassen, „leicht zugängliche“ Daten. Alles was vorher auf Papier geschrieben wurde, ist für jemanden von außen erst einmal schwer einsehbar. Da müsste jemand einbrechen und viele Laborbücher klauen. Heute werden die Daten jedoch digital abgelegt. Die Daten sind mit krimineller Energie „einfacher“ zugänglich, weil sie irgendwo abgelegt sind, beispielsweise in einer Cloud. Das müssen Unternehmen einplanen und sich davor schützen. Die Daten müssen so aufbereitet und abgelegt werden, dass sie nicht von Dritten einsehbar sind oder gehackt werden können.
Besonders sensibel ist auch Folgendes: Wir erfassen was Menschen tun, was sie machen und wie sie sich bewegen. Da geht’s natürlich in die Privatsphäre. Denn dadurch kann ausgewertet werden, wie lange Mitarbeiter brauchen. Wer ist schneller? Ich könnte theoretisch Mitarbeiter miteinander vergleichen. Das ist ein Nachteil, weil es Menschen von außen kontrollierbar macht. Aber das ist alles regelbar, finde ich. Beispielsweise durch die Einbeziehung des Betriebsrats, um zu klären, welche Daten genutzt werden dürfen und welche nicht. Da muss man sich absichern.
Uns als Weiterbildungsanbieter interessieren natürlich auch die Kompetenzanforderungen vom Laborpersonal. Ändern sich durch die Chancen und Risiken der neuen Technologien auch die Kompetenzanforderungen an Labormitarbeiter? Wird sich das Berufsbild wandeln?
Ja klar. Aber das tut es ja schon. Gerade am Beispiel unseres Roboters, den wir auf der „Labvolution“ – Kevin heißt er – vorgestellt haben, kommt immer wieder die Frage: Wollt ihr uns rationalisieren? Da sage ich dann immer: Wenn die Tätigkeit darin besteht, Platten von A nach B zu transportieren, dann ist der Roboter nicht das Problem. Diese nicht wertschöpfenden Tätigkeiten werden einfach, auch in Deutschland, immer schwieriger zu halten. Dafür ist die Arbeitskraft zu teuer.
Unternehmen verfügen häufig über einen „alten Kernstamm“ an Personal. Doch das neue Personal, das eingestellt wird, besteht meistens aus hochqualifizierten Leuten, die diese Standardtätigkeiten gar nicht mehr machen wollen. Die wollen sich um Forschung, Entwicklung und Experimentdesign kümmern. Im Privaten sind wir ja auch immer mehr mit Digitalisierung vertraut. Diesen Komfort wollen dann viele auch im Labor.
Das Berufsumfeld ändert sich. Es gibt Studien die sagen, dass die Mittelqualifizierung immer mehr wegfällt. Es gibt viel mehr hochqualifiziertes Personal, die Roboter steuern und mit diesen neuen Technologien umgehen müssen, mit Geräten umgehen müssen, die immer komplizierter werden.
Im Bereich der Dienstleistungen gibt es vermutlich auch Tätigkeiten, die nicht digitalisierbar sind, die dann keine qualifizierten Tätigkeiten sind.
Vielleicht ist Flexibilisierung ein gutes Beispiel. Wir wissen, dass der Mensch hoch flexibel bei der Abarbeitung seiner Aufgaben ist. Bei der Bearbeitung von Rechenoperationen am Computer ist er jedoch unterlegen. Auch beim Erfassen von komplexen Situationen wird der Mitarbeiter für Jahre eine zentrale Rolle einnehmen.
Ein Kunde von uns hat viel automatisiert, was für mich Teil der Digitalisierung ist. Dort fallen Jobs nicht weg, sondern es werden neue geschaffen. Durch Automatisierung können viel mehr Messergebnisse erzeugt werden. Nun braucht es dafür aber auch mehr Leute, beispielsweise zur Wartung der Anlagen. Und es braucht mehr Personen, die die Messergebnisse auswerten können.
Dass Digitalisierung Arbeitsplätze abschafft, stimmt also so nicht. Aber es sind die Bedenken der Mitarbeiter, die ernst genommen werden müssen.
Glauben Sie, dass sich das in der schulischen Ausbildung widerspiegeln wird – beispielsweise bei Technischen Assistenten? Die Frage ist ja auch, wie schnell die Ausbildung bei solch steigendenden neuen Anforderungen hinterher kommt.
Dazu kann ich nicht viel sagen. Was ich sagen kann, ist, dass sich natürlich auch die Universitäten umstellen müssen. Wir stellen bei unseren Studierenden immer fest, dass sie viel klassisches Handwerkszeug lernen. Aber in Hinblick auf Automatisierung und Digitalisierung im Labor gibt es noch Aufholbedarf. Im Berufsleben müssen sich neue Mitarbeiter, die frisch von der Uni kommen erst einmal auf die neuen Technologien einstellen. An der Uni lernen die Studenten sehr selbstständig zu arbeiten. Im Labor hingegen muss kooperiert und zusammengearbeitet werden. Das ist auch ein Widerspruch zur Uniausbildung. Praktische Schulungen zu Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten sind dann gefragt.
Können Sie in die Zukunft schauen? Wo stehen wir, an welchem Punkt sind wir gerade in Bezug auf die Digitalisierung im Labor?
Pauschalität ist da schwierig. Viele Labore sind in Hinblick auf Datennutzung noch schlecht aufgestellt. Wir sehen aber auch genau das Gegenteil. Es gibt Unternehmen, deren Datennutzung bereits hoch automatisiert ist. Wie lange wird es dauern? Schwer zu sagen. Es gibt jetzt immer mehr Technologien, die im Labor eingesetzt werden können. Da werden wir in den nächsten fünf Jahren große Sprünge sehen. Mein Gefühl sagt mir, dass Machine Learning von der Nutzbarkeit immer einfacher wird und peux à peux Einzug ins Labor halten wird. Das wird aber auch davon abhängen, inwieweit die Labore das wollen und offen dafür sind und die Benefits sehen. Ich glaube, da wird sich einiges tun.
Wir glauben nicht, dass der Mensch in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus dem Labor verschwunden sein wird. Es gibt noch viel manuelle Arbeit, die aber Schritt für Schritt durch digitale Technologien unterstützt werden wird.
Herr Freundel, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch.
Wie sieht die Laborautomatisierung aus? Hier ein Beispiel.
Diesen Beitrag hat die Autorin Anna Schramowski gemeinsam mit DGQ-Produktmanagerin Christina Eibert verfasst. Christina Eibert ist studierte Sozialwissenschaftlerin und Produktmanagerin bei der DGQ. Sie verantwortet die Trainings in den Bereichen Compliance, Datenschutz, Statistik und Cyber-Sicherheit. Besonders wichtig ist es ihr, praxisnahe und zukunftsorientierte Weiterbildungen zu entwickeln, von denen Teilnehmer und Unternehmen gleichermaßen profitieren.
Comments are closed.